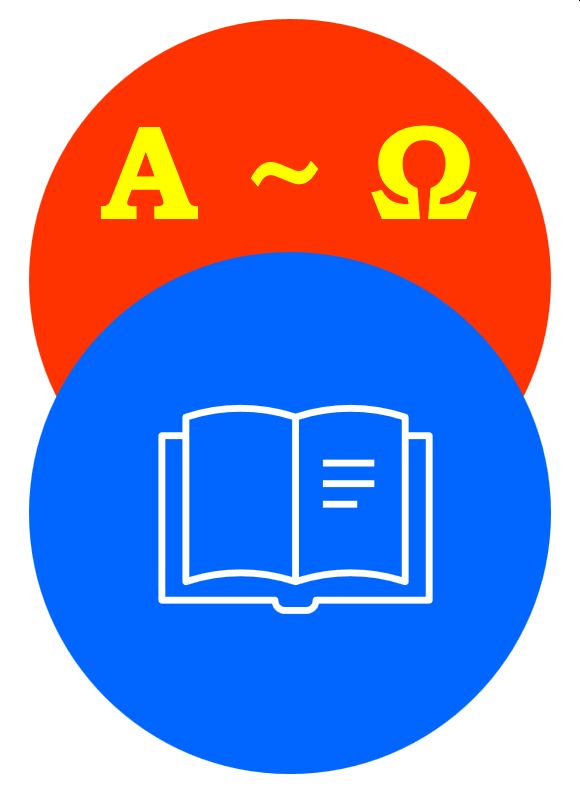Die unterschiedliche Behandlung des Sophia-Mythos im Tractatus Tripartitus, Apokryphon des Johannes und Manuskript „Pistis Sophia“ (Codex Askewianus).
Der Sophia-Mythos ist ein bedeutendes Thema in der gnostischen Literatur, insbesondere in den Texten, die als Apokryphon des Johannes, Tractatus Tripartitus und Pistis Sophia (Codex Askewianus) bekannt sind. Diese drei Werke beschäftigen sich mit Themen der göttlichen Weisheit (Sophia), weisen aber unterschiedliche theologische Rahmenbedingungen und Erzählstrukturen auf, die sich aus ihren jeweiligen Kontexten innerhalb der gnostischen Literatur ergeben. Um diese Unterschiede zu erklären, ist es notwendig, mehrere Schlüsselfaktoren in jedem Text zu berücksichtigen: den historischen Kontext, die theologische Betonung, die Erzählstruktur und die Rolle von Sophia.
- Historischer Kontext
Das pseudepigraphe Dialogevangelium Apokryphon des Johannes, von dem angenommen wird, dass es im frühen zweiten Jahrhundert n. Chr. verfasst wurde, ist einer der grundlegenden Texte des gnostischen Christentums. Es präsentiert eine komplexe Kosmologie, in der Sophia eine zentrale Rolle bei der Erschaffung der materiellen Welt und der Menschheit zukommt. Der Mythos betont hier ihren Fall in Ungnade und die anschließende Erlösung, was mit dem frühen gnostischen Denken übereinstimmt, das den Schöpfergott (Demiurg) oft bemängelt und Themen der Erkenntnis (Gnosis) und der Erlösung erforscht.
Die Abhandlung Tractatus Tripartitus, die dem gnostischen Lehrer Valentinus zugeschrieben wird, ist eine theologische Abhandlung, die verschiedene gnostische Ideen zu einem kohärenten System zusammenfasst. Es wurde wahrscheinlich im zweiten Jahrhundert n. Chr. verfasst und spiegelt frühchristliches Denken wider, das mit der hellenistischen Philosophie verflochten ist. Der Text zielt darauf ab, eine komplexe Kosmologie zu artikulieren, die mehrere göttliche Wesen und ihre Wechselwirkungen umfasst.
Das im Codex Askewianus enthaltene Manuskript Pistis Sophia, der wahrscheinlich im dritten oder vierten Jahrhundert n. Chr. geschrieben wurde, stellt eine spätere Phase in der gnostischen Entwicklung dar. Dieser Text ist ausführlicher und systematischer in der Darstellung der geistigen Erkenntnis und enthält ausführliche Dialoge zwischen Jesus und seinen Jüngern. Die Darstellung von Sophia konzentriert sich hier mehr auf ihre Rolle als Figur, die Erlösung durch Glauben und Verständigung sucht, als in erster Linie ihren Fall zu betonen. Das Werk dient sowohl als spiritueller Leitfaden als auch als Erzählung der Heilsgeschichte innerhalb des gnostischen Glaubens.

- Theologische Schwerpunkte
Im Apokryphon des Johannes dreht sich Sophias Erzählung um ihren Wunsch, den unerkennbaren Vater zu erkennen, was zu ihrem Absturz in Unwissenheit und Chaos führt. Dieser Mythos dient dazu, den gnostischen Glauben zu veranschaulichen, dass göttliche Weisheit durch die materielle Existenz verdunkelt wird. Der Text betont den Dualismus – zwischen Licht und Finsternis – und stellt Sophia als tragische Figur dar, deren Handlungen weitreichende Konsequenzen für sie selbst und die Menschheit haben.
Im Tractatus Tripartitus wird Sophia oft als Teil einer größeren göttlichen Hierarchie dargestellt, in der ihre Rolle eher durch philosophische Abstraktion zu verstehen ist. Sie verkörpert göttliche Weisheit, steht aber auch für die Spannung zwischen Unwissenheit und Erleuchtung innerhalb der Menschheit.
Pistis Sophia bietet eine persönlichere Erzählung, in der Sophias Figur emotionale Tiefe erfährt – ihre Trauer über ihren Fall und ihre Sehnsucht nach Wiedervereinigung mit dem Göttlichen. Sophia verkörpert nicht nur die Weisheit, sondern auch den Glauben (pistis), was eine optimistischere Sicht des geistigen Aufstiegs hervorhebt. Betont werden auch die Themen der Buße, des Leidens, der Erleuchtung und der Erlösung, die tief in der gnostischen Soteriologie (dem Studium der Erlösung) mitschwingen. Der Text skizziert verschiedene Stadien des geistigen Fortschritts, die Gläubige durchlaufen müssen, um die Einheit mit dem Göttlichen zu erreichen. Dies spiegelt eine breitere theologische Verschiebung innerhalb des Gnostizismus hin zu strukturierteren Wegen zur Erlösung wider.
- Erzählstruktur
Die Struktur der einzelnen Texte hebt ihre Unterschiede zusätzlich hervor. Im Apokryphon des Johannes entfaltet sich die Geschichte durch eine Reihe von Offenbarungen, die Jesus seinem Jünger Johannes gab und die eine direkte Weitergabe von geheimem Wissen darstellen. Dieses Format ermöglicht eine intime Auseinandersetzung mit theologischen Konzepten, kann aber aufgrund seines abstrakten Charakters weniger zugänglich sein.
Der Tractatus Tripartitus verwendet einen systematischen Ansatz, um verschiedene Aspekte des Gnostizismus durch philosophische Diskurse zu erörtern. Es fehlt ein zusammenhängender Erzählbogen in Bezug auf einzelne Charaktere wie Sophia. Stattdessen konzentriert sie sich auf abstrakte Konzepte wie Erkenntnis (Gnosis) und ihre Beziehung zur Erlösung.
Pistis Sophia entfaltet sich hingegen durch ein Dialogformat zwischen Jesus und seinen Jüngern nach seiner Auferstehung, was es interaktiver und pädagogischer macht. Präsentiert wird eine fesselnde Erzählung voller Gleichnisse, die geistliche Wahrheiten veranschaulichen.
Diese Struktur erleichtert nicht nur den Unterricht, sondern bindet die Zuhörer und Leser auch direkt in ihre Suche nach Erkenntnis ein. Hier wird Sophias Reise zu einem zentralen Thema, um den Kampf der menschlichen Existenz gegen die Unwissenheit und die kosmischen Mächte zu verstehen. Die Einbeziehung von Hymnen und Gebeten bereichert den liturgischen Aspekt dieses Textes zusätzlich.
- Die Rolle von Sophia
Obwohl Sophia in den drei Texten eine wichtige Rolle spielt, unterscheiden sich ihre Rollen erheblich. Im Apokryphon des Johannes wird sie vor allem als gefallene Figur dargestellt, deren Reise das Streben der Menschheit nach Erkenntnis inmitten der allgemeinen Unwissenheit symbolisiert. Ihre Geschichte dient als Allegorie für das spirituelle Erwachen durch Gnosis.
Beim Tractatus Tripartitus spielen auch kulturelle Einflüsse eine Rolle bei der Darstellung von Sophia. Das Werk spiegelt die frühchristlichen Debatten über Häresie versus Orthodoxie während seiner Entstehungszeit wider, als neben dem hellenistischen Denken verschiedene Interpretationen des Christentums auftauchten.
Im Gegensatz dazu gab es zu der Zeit, als Pistis Sophia geschrieben wurde, eine stärkere Integration mystischer Elemente aus verschiedenen Traditionen – einschließlich der jüdischen Mystik[1] –, was die Darstellung von göttlichen Figuren wie Sophia als besser zuordenbare Wesen beeinflusste, die in menschenähnliche Kämpfe verwickelt waren.
Pistis Sophia wird als aktive Teilnehmerin bei der Suche nach Erlösung an der Seite der Menschheit dargestellt. Ihr Charakter verkörpert sowohl Weisheit als auch Treue – eine Dualität, die Gläubige dazu ermutigt, sowohl nach intellektuellem Verständnis als auch nach aufrichtiger Hingabe zu streben.
Schlussfolgerung
Die Unterschiede zwischen den Darstellungen des Sophia-Mythos in den Werken Apokryphon des Johannes, Tractatus Tripartitus und Pistis Sophia lassen sich durch ihre unterschiedlichen Kontexte, theologischen Rahmen, Erzählstrukturen und kulturellen Einflüsse erklären, die ihre jeweiligen Darstellungen göttlicher Weisheit prägten.
Die jeweiligen Darstellungen des Sophia-Mythos weisen zwar gemeinsame Elemente in Bezug auf Sophias Wesen als eine Figur auf, die mit Weisheit und göttlicher Erkenntnis in Verbindung gebracht wird, sich aber aufgrund ihrer historischen Kontexte, theologischen Schwerpunkte, Erzählstrukturen und Darstellungen innerhalb des jeweiligen Textrahmens deutlich unterscheiden. Diese Unterschiede zeigen, wie sich das gnostische Denken im Laufe der Zeit entwickelt hat, während es sich immer noch mit grundlegenden Fragen über Göttlichkeit, Schöpfung und Erlösung auseinandersetzt.
Quellen: 1. Pagels, E. H. (1979). The Gnostic Gospels. 2. Meyer, Marvin (2007). The Nag Hammadi Scriptures.
[1] Zur jüdischen Mystik, oft mit der Kabbala verwechselt, siehe Dan, J. (2012). Die Kabbala: Eine kleine Einführung.