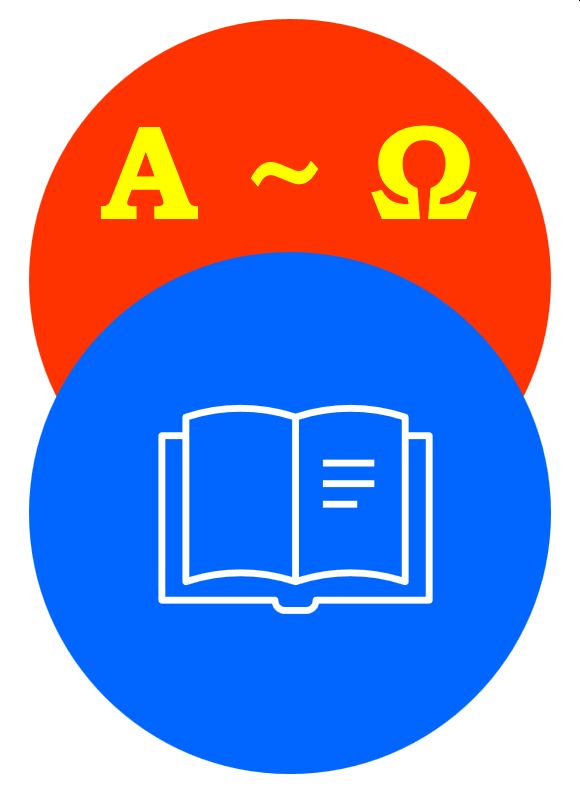Der Fehler der Sophia
Die gnostische Literatur umfasst verschiedene Versionen des Sophia-Mythos. Es kommt nicht selten vor, dass eine mythische Erzählung in mehreren Versionen vorliegt, sei es, weil sie von mehreren Autoren überliefert wurde, sei es, weil sie sich im Laufe der Zeit verändert hat. Denn der Übergang zur schriftlichen Fassung beendet nicht die Tradition der mündlichen Überlieferung, die bei der Weitergabe von Mund zu Mund leicht Änderungen oder Ergänzungen erfahren kann.
Daher stimmt die Darstellung des Sophia-Mythos im Apokryphon des Johannes grundsätzlich mit der im Tractatus Tripartitus (TracTrip ) und im Manuskript Pistis Sophia (Codex Askewianus) überein, weicht jedoch in den Einzelheiten – sogar erheblich – ab. Im Folgenden präsentiere ich eine Zusammenfassung der Version gemäß dem Tractatus Tripartitus.[1]
Bitte beachten: Der Verfasser des Tractatus Tripartitus nutzt den Namen „Logos“ für die Gestalt, die von anderen Valentinianern als Sophia bezeichnet wird. Zu den Gründen für diese Wahl wird auf die einschlägige Literatur verwiesen.[2]
Die anmaßende Verherrlichung durch den Logos
Die aus der vollständigen Übereinstimmung der Äonen mit dem Vater und dem Sohn resultierende Harmonie wurde durch die Übertretung eines kleineren Äons namens Sophia gestört, der es wagte, den unbegreiflichen Vater doch begreifen zu wollen, um ihn zu verherrlichen. Es handelte sich um einen Logos, der auf einer individuellen Ebene vollkommen war, jedoch nicht zu den Äonen gehörte, die aus einer Übereinstimmung aller Äonen im Pleroma oder vom Vater des Alls direkt hervorgebracht worden waren.
Dieser Logos gehörte zu einer Klasse von Äonen, die vom Vater mit Weisheit ausgestattet wurden. Alles was im Denken des Logos präexistierte, konnte er erschaffen. Der Grund, warum der Logos eine weise Natur erhalten hatte, lag darin, dass er als Frucht der Weisheit die verborgene Einrichtung untersuchen sollte, was „nur bedeuten kann, dass seine Bestimmung darin lag, alle Grade der Gnosis [Erkenntnis] durchzulaufen.“ (ET 361)
→ Kommentar: Wenn „verborgen“ hier für „noch nicht entstanden“ steht, könnte man unter „verborgene Einrichtung“ den zukünftigen Kosmos verstehen. Der Logos war also dazu prädestiniert, ein alternatives Szenario im Rahmen des erzieherischen Programms des Vaters auszutesten. Dass er nicht in dieses Programm eingeweiht wurde, war im Sinne des Vaters notwendig.
Aufgrund des autonomen Willens, mit dem die Äonen ausgestattet wurden, durfte der Logos tun, was er wollte, ohne von irgend jemandem eingeschränkt zu werden.
Seine Motivation war also positiv, da er den Vater loben wollte. Er wagte es dennoch, ein Unternehmen anzugehen, das seine Kräfte überstieg, weil er etwas Vollkommenes schaffen wollte durch eine Übereinstimmung, in der er sich nicht befand, und ohne dass ihm jemand darum gebeten hatte.
→ Kommentar: Der Fehler lag im inkorrekten Gebrauch der Eigenständigkeit, als das Logos eigenmächtig und ohne Verbindung zum übergeordneten Pleroma und ohne seinen Partner [Syzygos] von seinem Willen Gebrauch machte. Mit autonomem Willen ist gemeint, ‚eigenständig in Verbindung mit dem Vater und seiner Fülle zu handeln‘ und nicht bloß ‚eigenständig zu handeln‘.
ET 325: Die Äonen manifestieren den Vater nur, wenn sie ihn in einer Einheit geschlossen verherrlichen und seine unendliche und unteilbare Natur bewahren, vgl. ExcTh 32:1 (ähnlich Clem. Strom. IV 90:2). Nach TracTrip sowie anderen valentinianischen Quellen besteht die Krise, die schließlich zur Erschaffung der empirischen Welt führt, in der Singularität des Handelns eines der Äonen, welche nur ein minderwertiges Bild des Pleroma erzeugen kann (vgl. 77:15ff).
→ Kommentar: Das Unternehmen des Logos könnte darin gelegen haben, dass er versuchte, den unerforschlichen Vater direkt durch einen eigenmächtigen Gedanken zu erreichen, anstatt über den Sohn als dessen Manifestation im All zu gelangen. Dies führte zu seinem Fall. So gesehen, lag der Fehler darin, voreilig voranzuschreiten, ohne alle Stufen der Gnosis durchlaufen zu haben.
Dieser Äon gehörte nicht zu den ersten Äonen, die direkt vom Vater durch den Sohn gezeugt wurden und weitere Äonen hervorbrachten. Er war nach zeitlichen Maßstäben einer der letzten Äonen, die aus der gegenseitigen Hilfe unter den ersten Äonen entstanden, und zudem ein kleiner in Bezug auf sein Ausmaß.
Obwohl er bereits Erfahrungen im selbstständigen Zeugen einzelner Werke gesammelt hatte, war er noch nicht so weit entwickelt, um ein Werk auf einer höheren Ebene zu zeugen, in Übereinstimmung mit allen anderen Äonen, das des Sohnes würdig gewesen wäre. Aus edler Gesinnung und stürmischer Liebe fühlte er sich jedoch dazu bewegt, zur Grenze (Horos) zu gehen, die um die vollkommene Herrlichkeit gezogen ist.
→ Kommentar: Dem eigenmächtigen Willen, der dem Logos gewährt worden war, wurde offensichtlich eine Grenze gesetzt. Diese Grenze wurde von ihm verletzt.
Der Fall geschah in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters
Ebenso wie es der Wille des Vaters gewesen war, dass dieser Logos entstand, war es auch sein Wille, dass dieser Logos versuchte, sich etwas zu nähern, für das er noch nicht bereit war, und dabei scheiterte.
Der Vater ermöglichte das hochmütige Unternehmen des Logos mit all seinen Konsequenzen, um eine bestimmte Klasse von Wesen und die damit verbundene Einrichtung zu schaffen, deren Existenz er für notwendig hielt. Offensichtlich hätte diese Klasse von Wesen nicht anders entstehen können, und der Vater hatte seine Gründe dafür.
Aufgrund des Willen des Vaters zogen sich der Vater und die Äonen vom Logos zurück, um die vom Vater gewollte Grenze zu befestigen. Bei dieser Grenze handelt es sich nicht um die Grenze zwischen dem Vater und den Äonen, die das Erreichen der Unerreichbarkeit verhindern soll, sondern um eine zweite Grenze, die der Vater für notwendig hielt, um die Äonen vom gefallenen Logos und dessen Einrichtung getrennt zu halten.
→ Kommentar: Der Vater ließ nicht nur den Fall zu. Er wusste davon bereits im Voraus, weil es sein Wille war, dass es dazu kommen musste. Diese Interpretation findet ihre Bestätigung in AuthLog (NHC VI,3) 26:6-20: „Nichts aber ist ohne seinen Willen entstanden. Er nun, der Vater, gewillt, seinen Reichtum und seine Herrlichkeit zu offenbaren, setzte diesen großen Kampf in dieser Welt ein, weil er wollte, dass die Kämpfer sich zeigten ; dass alle Kämpfenden durch eine erhabene unfassbare Erkenntnis das Entstandene hinter sich lassen und es verachten und sich in das Seiende flüchten sollen; und dass wir die Unwissenheit derer, die als gegen uns streitende Widersacher mit uns kämpfen, durch unser Wissen besiegen sollen„.[3]
Der Vater und die Äonen zogen sich auch deswegen vom Logos zurück, damit dieser allein die Wesen und Werke zeugen konnte, die der Vater in Bezug auf die neue Einrichtung außerhalb des Pleroma gewünscht hatte. Die Unruhe des Logos war daher der Grund für das Entstehen einer Heilsordnung, die dazu bestimmt war, zu entstehen.
Diese neuen Wesen und Werke hätten nicht durch eine Offenbarung des Pleroma gezeugt werden können. Sie wären zu perfekt gewesen. Es bedurfte eines „versagenden“ Äons, um die Voraussetzungen für eine Welt des Versagens zu schaffen. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht angemessen, dem Logos Vorwürfe wegen seiner Unruhe zu machen.
→ Kommentar: Der Logos war ein Werkzeug des Willens des Vaters und handelte, ohne sich dessen bewusst zu sein, im Sinne des Vaters. Durch seinen Fehltritt entstand eine Dimension außerhalb der Fülle des Vaters, die eine mangelhafte Nachbildung dieser Fülle darstellte, doch der Vater hatte seine Gründe dafür, dass es so kommen musste.
Ein Grund dafür könnte sein, dass auch Wesen, die nicht in der idealen Umgebung des Pleroma erschaffen wurden, die Chance erhalten sollten, sich selbst und den Vater zu erkennen und letztlich vollkommen zu werden, um doch noch ins Pleroma zu gelangen. Wie im weiteren Verlauf des Textes deutlich wird, war der Logos in diesem Sinne der Wegbereiter einer solchen Entwicklung und verdient daher für diese Leistung volle Anerkennung.
I – Die Unruhe. „Unruhe“ ist ein Fachausdruck, der für „Leidenschaft“ steht, und in vergleichbaren Berichten über den Fall vorkommt, wie z.B. im AJ[4] [hier angewandt auf Gen. 1:2]: „Als aber die Mutter erkannte, dass die Fehlgeburt der Finsternis nicht vollkommen war, da ihr Gatte nicht mit ihr übereingestimmt hatte, kehrte sie um und weinte sehr„; „Die Mutter begann daraufhin, sich ‚hin und her zu bewegen‘ … Herr, was ist das ‚Sich-hin-und-her-Bewegen‘? … Er aber lächelte und sagte: „Denkst du, dass es so war, wie Moses gesagt hat ‚über den Wassern‘? Nein … Sie kehrte um, und während sie sich in der Finsternis des Unwissens ‚hin und her bewegte‘ begann sie, sich zu schämen.“; vgl. EV 26:15-19:[5] „Alle Wege kamen ins Schwanken und gerieten durcheinander … so dass die Täuschung (Plane = Irrtum) geängstigt ist … „
Der Begriff „Unruhe“ im TracTrip bezeichnet hingegen keine emotionale Erregung, und im AJ kann er nicht einfach als Paraphrase von ἐπιφέρω [schwebte] im Genesis-Text verstanden werden. Im vorliegenden Zusammenhang kann sich die „Bewegung“ nur auf die beabsichtigte Ursache des Untergangs beziehen: den Wunsch nach eigenständigem Handeln, das Vorwärtsstürmen und den „Hochmut“. Siehe Parallelliteratur ET 371.
II – Die Unruhe als „Bewegung“. Nach Plotin (Enneaden III 9.3) ist Bewegung eine Eigenschaft der Teilseele im Gegensatz zur universellen Seele, die weder irgendwo geboren wurde noch von irgend woher kam, „denn es gab keinen ‚Wo‘, sondern es war der Körper, der sich näherte und daran teilnahm„.[6]
Die Teilseelen haben dagegen ein Woher; sie gehen nämlich von der universellen Seele aus. Sie haben auch etwas, in was sie eingehen und übergehen können; daher können sie auch emporgehen. Die universelle Seele ist dagegen stets oben, worin sie ihrer Natur nach Seele ist. Die Bewegung des Logos wandte sich weg vom Vater, siehe unten.
III – der Plan des Vaters. Der Vater wurde nicht vom Fehler des Logos „kalt erwischt“. Ursächlich für den Fehler war nicht vorrangig das Bestreben des Logos, die Unerreichbarkeit zu erreichen. Vielmehr hatte der Vater den Fehler im Voraus gründlich eingeplant. Der Vater hatte, wie schon dargelegt, den Plan, alle Äonen von der Unvollkommenheit in die Vollendung zu überführen. Offensichtlich hatte der Vater für diesen speziellen Äon (Logos) ganz andere Pläne. Der Vater gestattete es dem Logos, sein überhebliches Unternehmen bis zu seinem unausweichlichen Misserfolg zu verfolgen, ohne korrigierend einzugreifen.
Dies hatte zur Folge, dass der Logos sich anschließend außerhalb des Pleroma fand und die Vorsehung (gr. Οικoνομία Oikonomia) mit der Schaffung der psychischen Realität sowie mit der Erlösung und Rückkehr des Logos zusammen mit der Rettung seiner Kreaturen ihren Lauf nahm. Der Fehler des Logos erfüllte daher eine bestimmte Aufgabe in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Das Wort ‚Vorsehung‘ bezieht sich hier auf den Plan des Vaters, neben den Äonen auch psychische Wesen aus weit entfernten Regionen außerhalb vom Pleroma ebenfalls zur Gnosis zu führen durch das, was man als Individuation (Selbstverwirklichung) bezeichnen könnte, zu deren Prozess auch Fehler gehören.
IV – Individuation. Für den Psychoanalytiker Carl Gustav Jung bedeutet Individuation „zum Einzelwesen werden, und, insofern wir unter Individualität unsere innerste, letzte und unvergleichbare Einzigartigkeit verstehen, zum eigenen Selbst werden. Man könnte ‚Individuation‘ darum auch als ‚Verselbstung‘ oder als ‚Selbstverwirklichung‘ übersetzen.„
Der Logos ist geteilt
Der Logos hatte sich selbst als einen ungeteilten und vollkommenen Äon gezeugt, zur Ehre des Vaters, der ihn gewollt hatte und mit ihm zufrieden war.
Die Dinge aber, die er begreifen und erreichen wollte, zeugte er als Schatten, Truggestalten und Nachbildungen, weil er es nicht ertrug, in das Licht zu blicken, sondern in die Tiefe blickte und zweifelte.
Aufgrund dessen trennte er sich und wandte er sich ab. Durch den Selbstzweifel und die Trennung kamen in ihm Vergessen und Unwissenheit über sich selbst und über das Seiende auf.
Dem Logos war es gelungen, sich selbst als einen ungeteilten und vollkommenen Äon zu zeugen, während er den Vater verherrlichen wollte, der ihn gewollt hatte und mit ihm zufrieden war.
Als er jedoch versuchte, nicht nur sich selbst, sondern auch andere Dinge – wahrscheinlich andere Äonen – zu erschaffen, musste er feststellen, dass es ihm diesmal nicht gelungen war, „lebendige Bilder der lebendigen Gestalten“, nämlich des Vaters und der Äonen, zu schaffen. Stattdessen entstanden minderwertige Abbilder von ihnen, die Schatten und trügerischen Gestalten glichen. Dies lag daran, dass er nicht mehr ins vertraute Licht blicken konnte, sondern immer mehr in die Tiefe starrte, und zwar umso mehr, je größer seine Selbstzweifel wurden.
→ Kommentar: Seine Selbstzweifel nahmen zu und verfestigten sich, bis ihm bewusst wurde, dass eine Trennung zwischen ihm und dem Vater sowie dem All bestand. Er hatte sich von jedem abgewendet. Das Licht war vom ihm abgerückt. Die Finsternis lag hingegen tief und offen vor ihm und er stürzte in sie hinein. Nachdem die Trennung vollzogen und zum dauerhaften Zustand seines Wesens geworden war, hatte der Logos seinen lichtvollen Ursprung bereits vergessen. Er hatte vergessen, wer er war. Alles, was er bis zu diesem Zeitpunkt über den Vater und das All erkannt hatte, schien verschwunden zu sein, als hätte der Vater nie existiert. Statt Licht sah er bloß finstere Gestalten und psychischen Stoff um sich herum.
Plotin III 9:3: Wenn die Teilseele sich dem zuwendet, was ihr vorausgeht, wird sie erleuchtet, da sie dem Sein begegnet. Wendet sie sich jedoch dem zu, was nach ihr kommt, so begegnet sie dem Nichtsein. Sie tut dies, indem sie sich sich selbst zuwendet, denn indem sie sich auf sich selbst konzentriert, erzeugt sie als Bild ihrer selbst das, was nach ihr kommt, das Nicht-Seiende, als würde sie durch die Leere gehen und unbestimmter werden. Und dieses völlig unbestimmte Bild ist dunkel, da es völlig ohne Vernunft und Verstand und weit vom Sein entfernt ist. [7]
Der Logos war überheblich gewesen, als er sich in dem festen Glauben wähnte, den Unerreichbaren erreichen zu können, und die Überheblichkeit wurde zu einem dauerhaften Bestandteil seiner Natur. Es entstand jedoch noch etwas Neues: das Leid. Der Logos wurde zu einem Wesen, das leiden konnte, während präexistierende und in alle Ewigkeit ungezeugte Wesen leidensunfähig sind.
Da sich der Logos von der Sphäre der Präexistenten getrennt hatte und in eine niedrigere Dimension, die der Psyche und der Materie, hinabgestiegen war, besteht das Ziel der Heilsgeschichte darin, die Seelen aus ihrer kosmischen und leidensfähigen Existenz zu befreien. Denn nun war die Fähigkeit, zu leiden, geboren und der Logos wurde zum ersten Opfer. Er begann nämlich unter Selbstzweifeln zu leiden, da er es nicht geschafft hatte, sich dem Vater zu nähern, dessen Erhabenheit grenzenlos ist.
Der Aufstieg des höheren Teils des Logos
Mit der Trennung des Logos vom Pleroma ging auch eine Trennung innerhalb des Logos einher. Der Teil des Logos, der sich als einen ungeteilten Äon hervorgebracht hatte, gab alles auf, was aus dem Mangel entstanden war, und trennte sich von allen minderwertigen Abbildungen, Schatten und trügerischen Gestalten, die aus einer unwirklichen Vorstellung hervorgingen und ihm fremd waren. Er eilte nach oben zu seinem Syzygienpartner im Pleroma und gesellte sich wieder zu seinen Äonbrüdern. Während der Teil des Logos, der sich selbst hervorgebracht hatte, sich als einen noch Vollkommeneren offenbarte, blieb der versagende Logos allein in der Finsternis und wurde schwach wie ein weibliches Wesen, das von seinem männlichen Element verlassen worden ist.
Selbstzeugung und Selbstspaltung. Einem geistigen Wesen ist es ebenso möglich, sich selbst zu zeugen, wie sich selbst zu teilen. Ein Äon zeugt sich selbst als das vollkommene Wesen, das es ist („Werde, was du bist“ [8]). Als der Logos durch einen Fehltritt seine Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung in der Fülle des Vaters verlor, reagierte er zunächst, indem sein „guter“ Anteil sich von seinem „bösen“ trennte. Während der „gute“ Teil sich wieder seiner Entwicklung widmen konnte, verharrte der „böse“ Teil im Dunkeln und wusste nicht, „wer er ist, was aus ihm geworden ist, wo er war und wohin er gebracht wurde, wohin er eilt, wovon er erlöst werden soll und was Geburt und Wiedergeburt sind.“[9]
Auch die dritte Generation des Logos, der Pneumatiker, ist von der Spaltung betroffen. Sie erfahren durch die Gnosis, dass sie unvollständig sind und nur durch eine Wiedervereinigung mit ihren vollkommenen Selbsten wieder vollständig und vollkommen werden können. Erst dann kann das Logos mit seinem vollkommenen Anteil wieder vereint und erlöst werden.
Alle Gedanken, die aus seiner Anmaßung resultierten und somit mangelhaft waren, entsprangen dem Anteil in ihm, der selbst mangelhaft war. Sein vollkommenes Selbst konnte jedoch nicht mit dem unvollkommenen Teil koexistieren. Aus diesem Grund trennte er sich und kehrte ins Pleroma zurück, zu seinem fortgeschritteneren Bruder, der stets für ihn da gewesen war, sowie zu den Brüdern im gesamten Pleroma, die ihn unterstützten. Er existierte weiter als Erinnerung im Pleroma für den Teil seiner selbst, der unten geblieben war, um diesen vor seiner Überheblichkeit zu bewahren.
Nach seinem Aufstieg wird der höhere Anteil klüger als zuvor (ExcTh 31:2). TracTrip verbindet dieses Thema mit dem der Erinnerung an den eigenen Ursprung und das wahre Sein, das im weiteren Textverlauf im Zusammenhang mit der Bekehrung mehrfach nach oben wiederkehrt. Sein strukturelles semantisches Gegenteil ist das Vergessen und die Unwissenheit.
Nachdem das höhere Selbst des Logos gerettet wurde und nach oben geflohen war, organisierte er zusammen mit seinem älteren Bruder, der ihm zur Hilfe geeilt war, und dem Pleroma die Erlösung des Logos, indem sie ein Wesen zeugten, das die Kraft hatte, die minderwertigen Abbildungen, Schatten und trügerischen Gestalten, die im Mangel entstanden waren, zu stürzen.
[1] Paraphrasierte Zitate. Quelle: Schenke, H., Bethge, H. & Kaiser, U. U. (2001). Nag Hammadi Deutsch: Bd. NHC I,1-V. 1. de Gruyter.
[2] Siehe insbesondere Einar Thomassen, The tripartite tractate from Nag Hammadi : a new translation with introduction and commentary, 1982. Zitate aus diesem Werk werden mit “ET” gekennzeichnet.
[3] Alle direkte Zitate (NHD) aus: Schenke, H., Bethge, H. & Kaiser, U. U. (2001). Nag Hammadi Deutsch: Bd. NHC I,1-V. 1. de Gruyter.
[4] NHD
[5] NHD
[6] Plotino. (2013). Enneadi. Utet Libri. Übersetzung des Zitats aus dem IT durch den Autor dieses Artikels.
[7] Plotino. (2013). Enneadi. Utet Libri. Übersetzung des Zitats aus dem IT durch den Autor dieses Artikels.
[8] Maxime des griechischen Dichters Pindar, von Friedrich Nietzsche mit den Worten, „Werde der, der du bist“ übersetzt. Siehe auch Nietzsches Werk „Ecce homo. Wie man wird, was man ist“.
[9] ExcTh 78
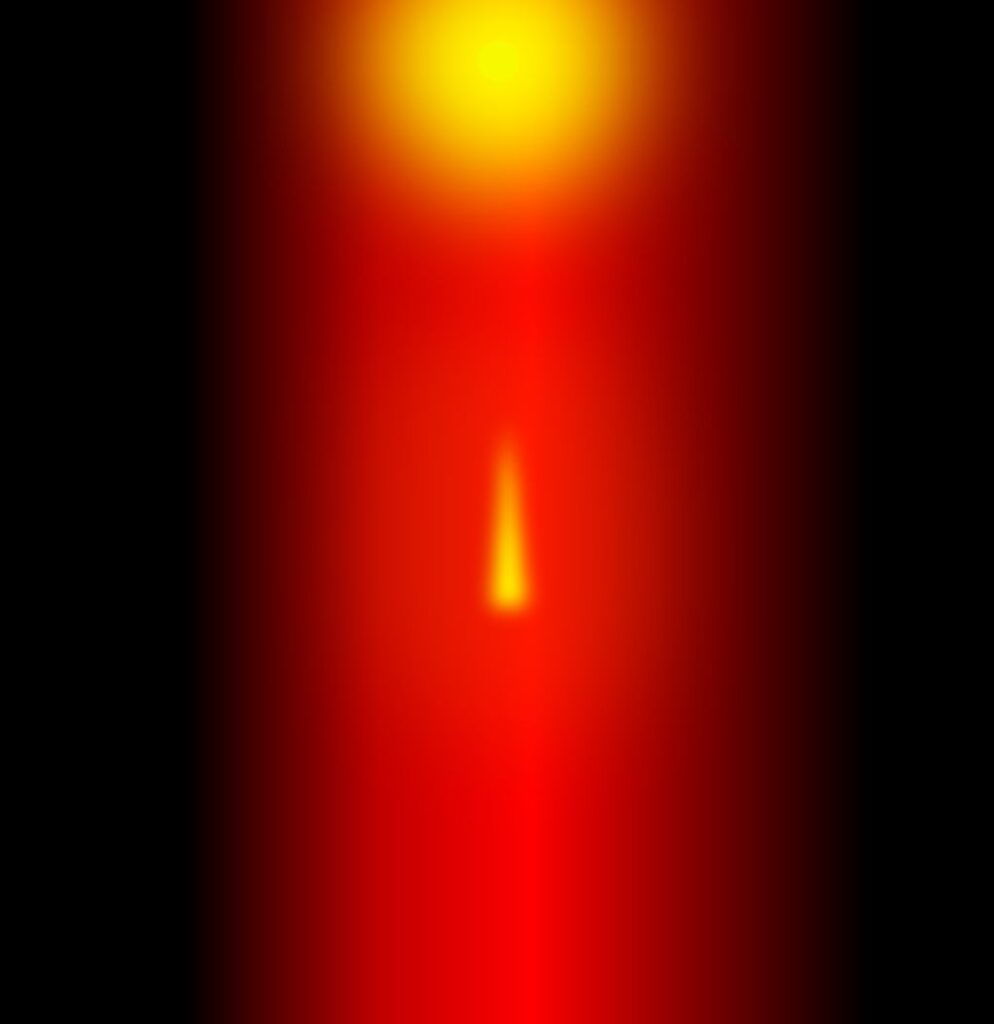
Schwerpunkte des Gnostizismus
Einleitung
DIE GNOSIS
DER ANFANG (DAS ALPHA)
- Der Vater
- Der Sohn
- Die Äonen
DER FALL
- Der Fehler der Sophia
- Der Herrscher dieser Welt
- Der Mensch
DIE UMKEHR
- Die Reue der Sophia
- Die Mission des Sohnes
- Die drei menschlichen Gattungen
DIE ERLÖSUNG
- Der Erlöser
- Die Erlösung
DAS ENDE (DAS OMEGA)
- Aufstieg und Wiederherstellung